Die dunkle Wahrheit hinter den Wikingern (Mit Video)
- Michael Praher

- 19. Mai 2025
- 7 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 12. Aug. 2025

Inhaltsverzeichnis:
Einleitung: Der Mythos vom „edlen Barbaren“
Wikinger – der Begriff ruft heute Bilder hervor von mutigen Entdeckern, unerschrockenen Kriegern, faszinierenden Ritualen und einer fast schon romantisch verklärten „nordischen Wildheit“. In Filmen, Videospielen und populärer Literatur werden sie als tapfere Helden dargestellt, die mit Axt und Langschiff eine eigene, raue Weltordnung schaffen.
Doch dieses Bild ist nur ein Ausschnitt. Die Geschichte der Wikinger war auch eine Geschichte der Gewalt, der sozialen Ungleichheit, der Versklavung und des kulturellen Niedergangs. Die Wahrheit ist unbequem, aber notwendig, um die Wikinger nicht als idealisierte Mythenfiguren zu betrachten – sondern als Menschen ihrer Zeit: fähig zu Großem, aber ebenso zu Grausamem.
Der Beginn der Wikingerzeit: Schrecken über Europa
Lindisfarne 793 – Ein Fanal
Die erste schriftlich dokumentierte Wikingerattacke traf ein religiöses Zentrum: das Kloster Lindisfarne an der Küste Nordenglands. Die Angelsächsische Chronik beschreibt den Überfall als eine göttliche Strafe:
„Schreckliche Vorzeichen erschienen über Northumbrien, und die Heiden vernichteten mit Plünderung und Mord das heilige Haus Gottes in Lindisfarne.“
Dieser Überfall im Jahr 793 n. Chr. markiert den Beginn der sogenannten Viking Age – eine Epoche von rund 250 Jahren, in der skandinavische Krieger weite Teile Europas heimsuchten.
Sie kamen schnell, brutal und meist unvorhergesehen – dank ihrer hoch entwickelten Langschiffe, die sowohl auf offener See als auch auf Flüssen operieren konnten. Küstenstädte, Dörfer, Kirchen und Handelsplätze waren oft wehrlos. Es war kein Krieg im klassischen Sinne, sondern eine Serie gezielter Überfälle – effizient, skrupellos, gnadenlos.
Das Ziel: Gold, Silber – und Menschen
Was die Wikinger suchten, war nicht immer Land oder Macht – sondern Beute. Besonders Klöster waren beliebte Ziele: unbewaffnet, reich an Schätzen, schwer erreichbar für reguläre Truppen. Orte wie Dorestad, Hamburg, Paris und Dublin wurden mehrfach geplündert.
Zeitgenössische Berichte, etwa von Einhard (Biograf Karls des Großen), zeugen von der Ohnmacht der fränkischen Eliten, dieser neuen Bedrohung etwas entgegenzusetzen. Es war eine Zeit des kollektiven Traumas – in der der Begriff „Wikinger“ zum Inbegriff des Bösen wurde.
Sklaverei – Die verdrängte Wirtschaftskraft
Thralls: Die Unsichtbaren der Wikingerzeit
In modernen Darstellungen wird gern betont, wie sehr die Wikinger gehandelt, entdeckt oder gekämpft haben – aber ein entscheidender Teil ihrer Wirtschaft wird oft verschwiegen: der großflächige Menschenhandel.
Der Begriff „Thrall“ (altnordisch: þræll) bezeichnete Sklaven, die keinerlei Rechte hatten. In der Praxis bedeutete das:
Sie konnten gekauft, verkauft, vererbt oder getötet werden.
Körperliche Gewalt und sexuelle Ausbeutung waren allgegenwärtig.
Viele wurden bei Bestattungen geopfert – als Prestigeobjekte des Adels.
Zentren des Sklavenhandels
Städte wie Hedeby, Dublin, Birka und York entwickelten sich zu florierenden Umschlagplätzen für Sklaven. Auch Fernhandel bis ins Kalifat der Abbasiden ist archäologisch belegt. Bernstein, Pelze und Waffen wurden gegen Silber und Seide getauscht – aber auch gegen Menschen.
Besonders irische, slawische und angelsächsische Bevölkerungen waren von Versklavung betroffen. Der Menschenhandel war nicht nur Nebeneffekt der Raubzüge – er war ein integraler Bestandteil des Systems.
Gewalt als soziales Prinzip – innen wie außen
Ehrenmord, Fehde und Blutrache
Die Gewalt der Wikinger richtete sich nicht nur nach außen, gegen Klöster und Städte – sie war tief in der eigenen Gesellschaft verankert. Im Mittelpunkt stand ein ausgeprägter Ehrbegriff (drengskapr), der durch Mut, Stärke und Loyalität definiert war. Doch diese Ehre musste immer wieder verteidigt – und notfalls mit Blut wiederhergestellt werden.
Typische Merkmale der innergesellschaftlichen Gewaltordnung:
Fehden waren legitimiert: Wer einen Angehörigen verlor, hatte die moralische Pflicht zur Rache.
Thing-Versammlungen konnten zwar über Schuld und Buße entscheiden – doch das Urteil wurde oft durch die Familie des Opfers vollstreckt.
Ehrverletzungen, z. B. durch Spottverse oder Beleidigungen, konnten tödliche Konsequenzen haben.
Die Isländersagas, auf die sich viele moderne Vorstellungen stützen, sind voll von persönlichen Streitigkeiten, Heimtücke und brutaler Vergeltung. Oft ging es nicht um Recht – sondern darum, keine Schwäche zu zeigen.
Blutadler & Berserker: Mythische Gewalt oder Realität?
Ein Beispiel für die ins Extreme überhöhte Gewalt ist der sogenannte Blutadler, eine angebliche Hinrichtungsform, bei der dem Opfer bei lebendigem Leib die Rippen geöffnet und die Lungen herausgezogen wurden – als blutige „Adlerflügel“. Historiker streiten, ob es sich dabei um ein reales Ritual oder um ein poetisches Missverständnis handelt.
Ein weiteres Beispiel sind die Berserker – Krieger, die sich in eine ekstatische Raserei stürzten. Ob sie unter Drogeneinfluss standen, psychisch instabil waren oder Rituale nutzten, ist unklar. Doch sie galten als gefährlich – nicht nur für Feinde, sondern auch für die eigene Gemeinschaft.
Frauen bei den Wikingern – zwischen Selbstbestimmung und Unterdrückung
Rechte, die überraschen …
Wikingerfrauen hatten im Vergleich zu anderen Kulturen des Frühmittelalters gewisse Rechte, die heute oft hervorgehoben werden – mit Recht:
Sie konnten Besitz erben, Verträge abschließen und sich scheiden lassen.
Viele führten Höfe oder Handelsunternehmen in Abwesenheit ihrer Männer.
Runeninschriften und Grabbeigaben belegen, dass Frauen religiöse, wirtschaftliche oder soziale Rollen einnahmen.
In Einzelfällen zeigen Gräber (wie das berühmte von Birka, Grab Bj 581), dass Frauen sogar als Kriegerinnen bestattet wurden – was zu Spekulationen über die Existenz sogenannter Schildmaiden geführt hat.
… und eine Realität, die oft erschreckte
Doch diese Freiheiten galten nicht für alle Frauen – und auch nicht in jeder Lebenslage:
Versklavte Frauen hatten keinerlei Rechte und wurden systematisch sexuell ausgebeutet.
Mädchen aus eroberten Gebieten wurden oft zwangsverheiratet, verkauft oder in den Haushalt verschleppt.
In archäologischen Funden (z. B. aus Großbritannien und Island) zeigen weibliche Skelette überproportional viele Anzeichen von Unterernährung, harter Arbeit und Gewalt.
Das Ideal der „freien Wikingerfrau“ trifft also nur auf eine kleine, privilegierte Schicht zu – und selbst dort war der Handlungsspielraum oft von patriarchalen Normen geprägt.
Soziale Härte – das Leben der unteren Klassen
Nicht alle waren Krieger oder Händler
Die populären Darstellungen von Wikingern zeigen fast ausschließlich Adel, Krieger oder Entdecker – doch die Mehrheit der Bevölkerung bestand aus freien Bauern, Tagelöhnern und Thralls (Sklaven).
Das Leben war geprägt von:
harte landwirtschaftliche Arbeit
kalten Wintern, Hungerzeiten und Krankheiten
streng hierarchischen Strukturen, in denen Aufstieg kaum möglich war
Auch viele „freie Männer“ lebten unter ständigem Druck: Wer sich nicht wehrte oder keine Ehre besaß, verlor seine Stellung – oder sein Leben.geist – ja. Aber eben auch rücksichtsloser Umgang mit Ressourcen und Menschenleben.
Die Kehrseite der Expansion
Die Wikinger werden heute gern als mutige Entdecker dargestellt – als Seefahrer, die weit über die Grenzen ihrer Welt hinausblickten. Und tatsächlich: Ihre Fahrten nach Island, Grönland und sogar Nordamerika waren beeindruckend. Doch diese Expansion hatte auch verheerende Nebenwirkungen.
Ökologische Schäden
Ein besonders deutliches Beispiel ist Island, das um 870 n. Chr. besiedelt wurde:
Innerhalb weniger Jahrhunderte wurden große Teile der Insel abgeholzt – ursprünglich war Island zu etwa 40 % bewaldet, heute sind es unter 1 %.
Die intensive Weidewirtschaft mit Schafen führte zu Bodenerosion, die bis heute spürbar ist.
Auch in Grönland litten die nordischen Kolonien unter Übernutzung der Ressourcen, verbunden mit Klimaveränderungen (Kleine Eiszeit).
Kulturelle Verluste in eroberten Gebieten
Wo Wikinger landeten, folgten nicht nur Handel oder kultureller Austausch – sondern oft Zerstörung:
In England, Irland und dem Frankenreich wurden unzählige Kirchen, Klöster und Archive vernichtet.
Wissen, Handschriften und Kunstschätze fielen den Raubzügen zum Opfer – Verluste, die bis heute nicht abschätzbar sind.
In Regionen wie Nordostengland oder Nordfrankreich wurden ganze Dörfer ausgelöscht, die Bevölkerung versklavt oder vertrieben.
Die Wikingerzeit war also nicht nur eine Zeit des Aufbruchs – sondern auch eine Epoche des kulturellen Rückschritts für viele Regionen Europas.
Zwischen Mythos und Realität – Wie das Heldenbild entstand
Warum also ist das Bild der Wikinger heute so positiv besetzt – trotz all dieser Abgründe?
1. Romantisierung im 19. Jahrhundert
Im Zeitalter des Nationalismus wurde nach heroischen Ursprüngen gesucht. Germanische und nordische Wurzeln galten als „rein“, „edel“ und „kämpferisch“ – das perfekte Gegenbild zu degeneriert wahrgenommenen Metropolen.
Literaten wie Richard Wagner (z. B. „Ring des Nibelungen“) verwoben nordische Motive mit politischem Pathos.
Historiker glorifizierten die Wikinger als Pioniere nordischer Zivilisation – mit viel mehr Bewunderung als kritischer Analyse.
Archäologische Funde wurden oft selektiv interpretiert, um vorhandene Narrative zu bestätigen.
2. Die Macht der Popkultur
Fernsehserien, Videospiele und Filme haben das Wikingerbild weiter verzerrt – und gleichzeitig populär gemacht:
Serien wie „Vikings“ oder „The Last Kingdom“ zeigen zwar Gewalt, aber meist als notwendig oder heldenhaft.
In „Assassin’s Creed Valhalla“ werden Wikinger zu rebellischen Individualisten stilisiert – mit Tattoos, Idealen und Loyalität.
Auch in Fantasy-Genres wird das Wikingermotiv oft verwendet, um eine archaische, rohe Kraft zu inszenieren.
Diese Darstellungen sind visuell stark, emotional wirksam – aber historisch oft hochgradig ungenau.
3. Moderne Projektionen
Der Wikinger ist heute Symbol für:
Freiheit und Individualismus
Stärke und Widerstand gegen Autorität
Männlichkeit und Naturverbundenheit
In Zeiten von Unsicherheit und Komplexität sehnen sich viele nach einfachen Bildern und klaren Identitäten. Der Wikinger wird so zur Projektionsfläche für moderne Bedürfnisse, nicht zur historischen Figur.nzen Komplexität zu zeigen – nicht, um zu verurteilen, sondern um zu verstehen.
Fazit: Keine Helden, keine Dämonen – sondern Menschen
Die dunkle Wahrheit über die Wikinger liegt nicht in einer pauschalen Anklage – sondern in der Einsicht, dass kein historisches Volk nur Licht oder nur Schatten war.
Die Wikinger waren:
mutige Entdecker – und gnadenlose Krieger
brillante Händler – und skrupellose Sklavenhalter
Träger einer faszinierenden Kultur – und Täter tiefgreifender Zerstörung
Wer die Wikinger verstehen will, muss sich von eindimensionalen Bildern lösen. Nur eine differenzierte Betrachtung wird ihrer Komplexität gerecht – und macht deutlich, dass Geschichte immer mehrdeutig ist.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zur dunklen Seite der Wikinger
Was machten die Wikinger mit ihren Gefangenen?
Viele Gefangene wurden versklavt und als „Thralls“ verkauft oder zur Arbeit gezwungen. Besonders Frauen und Kinder wurden oft sexuell ausgebeutet oder zwangsverheiratet.
Gab es wirklich so viel Gewalt in der Wikingerzeit?
Ja. Gewalt war ein alltägliches Mittel zur Konfliktlösung – sei es durch Blutrache, Fehden oder politische Auseinandersetzungen. Auch innerhalb der Gesellschaft wurde Gewalt zur Durchsetzung von Macht und Ehre akzeptiert.
Hatten Frauen bei den Wikingern wirklich viele Rechte?
Teilweise. Freigeborene Frauen konnten erben, sich scheiden lassen und Eigentum verwalten. Gleichzeitig waren sie Männern unterstellt, und viele Frauen – vor allem Sklavinnen – litten unter systematischer Unterdrückung und Gewalt.
Warum wird das Bild der Wikinger heute oft romantisiert?
Die Verklärung begann im 19. Jahrhundert durch nationalistische Ideologien und wurde in der Popkultur weitergetragen. Filme, Serien und Games zeigen Wikinger meist als edle Krieger – nicht als brutale Realität ihrer Zeit.
Haben Wikinger wirklich so viel zerstört?
Ja. Ihre Raubzüge führten zur Zerstörung zahlreicher Kirchen, Klöster, Städte und kultureller Zentren. Auch ökologisch hinterließen sie Spuren – etwa durch massive Abholzung in Island.

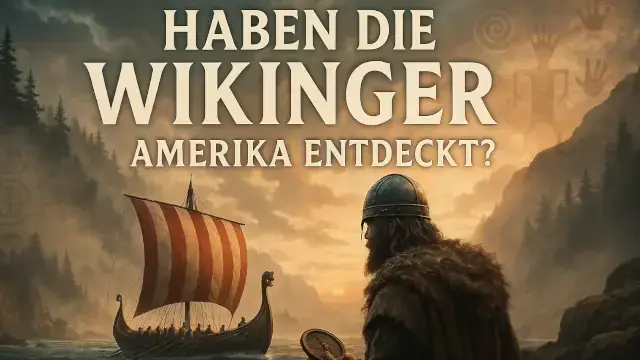









Kommentare