Bedeutende Wikingerfunde 2011 bis 2021 – Von weiblichen Kriegern bis High-Tech-Archäologie
- Michael Praher

- 25. Sept. 2025
- 7 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 27. Okt. 2025

Inhaltsverzeichnis:
🔸 Fazit
🔸 FAQ
Einleitung
Im 21. Jahrhundert hat die Wikingerforschung einen enormen Sprung gemacht. Dank modernster Technologien wie DNA-Analysen, Georadar und Dendrochronologie konnten Forscher nicht nur neue Fundplätze entdecken, sondern auch alte Rätsel lösen.
Die Jahre seit 2011 brachten spektakuläre Schätze, revolutionäre Erkenntnisse über Geschlechterrollen und einige der bedeutendsten Schiffsgrabungen seit über 100 Jahren. Diese Funde zeigen eindrucksvoll, dass die Wikingerarchäologie lebendiger ist denn je – und dass unser Bild der Nordmänner sich auch heute noch verändert.
Schatz- und Grabfunde
2011: Der Silverdale-Schatz und die Münze eines unbekannten Wikingerkönigs
Im Jahr 2011 wurde in Silverdale, Lancashire (England) ein Schatz mit über 200 Münzen, Schmuckstücken und Silberbarren entdeckt. Unter den Münzen befand sich ein Stück, das für Aufsehen sorgte: Sie trägt die Inschrift „Airdeconut“ – ein bislang unbekannter Wikingerkönig, der im 9. Jahrhundert in Nordengland geherrscht haben muss.
Dieser Fund veränderte das Bild der politischen Strukturen in England: Offensichtlich gab es weit mehr regionale Herrscher in der Wikingerzeit, als bisher in den Quellen greifbar war. Der Silverdale-Schatz zeigt, dass wir noch längst nicht alle Namen und Akteure dieser Epoche kennen – und dass Metallfunde immer wieder Überraschungen bereithalten können.
2011: Das Ardnamurchan-Bootsgrab (Schottland)
Im selben Jahr stießen Archäologen in Ardnamurchan, an der Westküste Schottlands, auf ein vollständiges Bootsgrab – das erste, das je auf dem britischen Festland gefunden wurde.
Der Tote war ein Mann, bestattet mit Waffen, einer Trinkschale und Werkzeugen. Obwohl das Boot stark verfallen war, konnten die Archäologen anhand der Nieten und Holzreste die Form rekonstruieren.
Besonders bedeutend ist dieses Grab, weil es einzigartig für Großbritannien ist: Während Bootsgräber sonst fast nur aus Skandinavien bekannt sind, beweist Ardnamurchan die kulturelle Verankerung nordischer Bestattungssitten auch auf den britischen Inseln. Es unterstreicht, wie eng verflochten die Kulturen im Nordatlantikraum im 9. und 10. Jahrhundert waren.
Funde der Mitte 2010er – Schätze und Festungen
2014: Der Galloway Hoard (Schottland)
Im Jahr 2014 machte ein Hobby-Metalldetektorist im Südwesten Schottlands eine Entdeckung, die von Fachleuten schnell als einer der bedeutendsten Schatzfunde der Wikingerzeit bezeichnet wurde: den Galloway Hoard.
Dieser Schatz umfasst über 100 Objekte, darunter Silberbarren, Schmuckstücke, Münzen, Goldfragmente und sogar seltene Textilien. Besonders spannend ist, dass viele Stücke aus ganz unterschiedlichen Regionen stammen – darunter anglo-sächsische, irische, fränkische und skandinavische Arbeiten.
Der Hoard ist einzigartig, weil er nicht einfach nur ein Hort von Edelmetall ist. Er enthält auch persönliche Gegenstände wie ein silbernes Kreuz mit Gravuren, das wahrscheinlich einem Geistlichen gehörte, und kleine Goldstücke, die in Ledersäckchen versteckt waren. Einige Objekte wurden so kunstvoll verborgen, dass Archäologen den Schatz eher als eine Sammlung denn als eine simple „Vergrabung“ interpretieren.
Die Untersuchung läuft bis heute: Besonders die feinen Textilreste und Inschriften könnten noch viele Geheimnisse über den Glauben, die Identität und die internationalen Verbindungen der Wikinger im 9. Jahrhundert offenbaren. Der Galloway Hoard zeigt eindrucksvoll, wie vielschichtig und kosmopolitisch die Wikingerkultur war.
2014: Die Ringburg Borgring (Dänemark)
Im selben Jahr wurde in Dänemark mithilfe von Lidar-Technologie (Laserscans aus der Luft) eine sensationelle Entdeckung gemacht: die Wikingerfestung Borgring auf Seeland.
Die kreisrunde Anlage gehört zu den sogenannten Trelleborg-Burgen, die im späten 10. Jahrhundert unter König Harald Blauzahn entstanden. Mit etwa 145 Metern Durchmesser und klar symmetrischem Aufbau passt Borgring perfekt in das bekannte Schema dieser Festungen – und doch ist sie einzigartig, da sie die erste Neuentdeckung dieser Art seit über 60 Jahren war.
Borgring bestätigte, dass die Wikinger über eine hochentwickelte militärische Organisation verfügten. Die Burgen dienten nicht nur der Verteidigung, sondern auch der Machtdemonstration. Ihre präzise Geometrie und standardisierte Bauweise sprechen für eine zentrale Planung und ein starkes Königtum.
Die Entdeckung von Borgring zeigt, wie moderne Technik völlig neue Zugänge zur Archäologie eröffnet: Ohne Laserscans aus der Luft wäre die Festung unter den landwirtschaftlichen Feldern wohl unentdeckt geblieben.
Wissenschaftliche Durchbrüche ab 2016
2016 (publiziert): Das Winterlager von Torksey (England)
Archäologische Untersuchungen in Torksey (Lincolnshire) bestätigten, dass hier im Winter 872/873 das Große Heidnische Heer lagerte – die berüchtigte Wikingerarmee, die große Teile Englands verwüstete.
Über Jahrzehnte hinweg fanden Metalldetektoren tausende Münzen, Gewichte und Schmuckfragmente in der Region. Neuere systematische Grabungen zeigten, dass es sich nicht um verstreute Einzelfunde handelte, sondern um das bisher größte bekannte Winterlager der Wikinger in England.
Besonders spannend: Neben militärischen Spuren fanden sich auch Hinweise auf Handel, Handwerk und Alltag – vom Gießen von Münzen bis zur Textilproduktion. Das Lager war also nicht nur ein Stützpunkt für Kriegszüge, sondern auch ein Ort wirtschaftlicher Aktivität. Damit verändert Torksey unser Bild von den Wikingern als reine „Eroberer“ und zeigt, dass selbst Heere komplexe Strukturen mit sich brachten.
2017: Die Birka-Kriegerin – eine Frau im Kriegergrab
2017 sorgte ein wissenschaftlicher Artikel weltweit für Schlagzeilen: Im schwedischen Birka war bereits im 19. Jahrhundert ein reich ausgestattetes Kriegergrab (Bj 581) entdeckt worden. Es enthielt Waffen, zwei Pferde und militärische Ausrüstung – lange Zeit war man überzeugt, dass hier ein männlicher Krieger bestattet lag.
Doch eine DNA-Analyse brachte die Sensation: Die bestattete Person war eine Frau. Damit war erstmals zweifelsfrei belegt, dass Frauen in der Wikingerzeit nicht nur symbolisch, sondern auch tatsächlich als Kriegerinnen auftreten konnten.
Die Veröffentlichung löste eine breite Debatte aus – sowohl in der Fachwelt als auch in der Öffentlichkeit. Kritiker merkten an, dass Waffen im Grab nicht zwangsläufig aktive Kriegsbeteiligung beweisen. Befürworter betonten hingegen, dass die Ausstattung klar auf eine militärische Rolle hindeutet.
Unabhängig von der Interpretation bleibt das Grab der Birka-Kriegerin ein Schlüsselfund, der unser Verständnis von Geschlechterrollen in der Wikingerzeit nachhaltig verändert hat.
2018 (publiziert): Die Repton-Neudatierung
Schon in den 1980er Jahren hatte man in Repton (Derbyshire, England) ein Massengrab mit über 200 Individuen gefunden, das lange mit dem Großen Heidnischen Heer von 873/874 in Verbindung gebracht wurde. Doch frühe Radiokarbon-Daten hatten Zweifel aufkommen lassen – einige Skelette schienen älter zu sein.
2018 gelang es mit neuen Methoden (Korrektur des „Meeresfrüchte-Effekts“ bei der Radiokarbonmessung), die Datierung zu präzisieren. Ergebnis: Die Toten stammten tatsächlich aus der Zeit des Großen Heeres.
Damit bestätigte sich, dass Repton ein zentraler Ort der wikingerzeitlichen Kriegsführung in England war. Der Fund verbindet erstmals schriftliche Quellen über das Heer direkt mit einem archäologischen Beleg.
Großgrabungen und Naturfunde ab 2018
2018/2020–2021: Das Gjellestad-Schiff (Norwegen)
2018 entdeckten Forscher mithilfe von Georadar im ostnorwegischen Gjellestad die Überreste eines großen Wikingerschiffs, das in einem Grabhügel lag. Diese Entdeckung war eine Sensation, denn seit den berühmten Funden von Oseberg und Gokstad Anfang des 20. Jahrhunderts war in Norwegen kein Schiffsgrab mehr gefunden worden.
Das Gjellestad-Schiff war stark beschädigt, doch die archäologische Bedeutung ist gewaltig: Es handelt sich um einen Elitebestattungsplatz, der mehrere Jahrhunderte lang genutzt wurde. Ab 2020 begannen die großangelegten Ausgrabungen, die bis 2021 andauerten.
Der Fund ist nicht nur wegen des Schiffs spannend, sondern auch wegen der angewandten Technik: Bodenradar machte es möglich, die Struktur unter der Erde sichtbar zu machen, ohne zunächst graben zu müssen. Damit eröffnen sich völlig neue Perspektiven, weitere verborgene Schiffsgräber in Skandinavien zu entdecken.
2020: Der Lendbreen-Pass (Norwegen)
Im Jahr 2020 sorgte ein ganz anderer Fund für Aufsehen – ausgelöst durch den Klimawandel. Das Schmelzen eines Gletschers im norwegischen Lendbreen-Pass legte eine Vielzahl von Objekten frei, die Reisende in der Wikingerzeit zurückgelassen hatten.
Unter den Funden waren Schuhe, Pferdeausrüstung, Pfeile, Schlittenreste und sogar Textilien. Dendrochronologische Analysen zeigten, dass der Pass besonders in der Wikingerzeit (8.–10. Jahrhundert) stark genutzt wurde.
Dieser Fund ist ein einmaliges Fenster in den Alltag: Er zeigt, wie Wikinger nicht nur über das Meer, sondern auch über beschwerliche Gebirgspfade Handel trieben und reisten. Zugleich ist er ein Beispiel dafür, wie der Klimawandel heute archäologische Funde sichtbar macht, die zuvor Jahrtausende im Eis verborgen lagen.
2021: Neue Datierung von L’Anse aux Meadows (Kanada)
Schon 1960 war L’Anse aux Meadows in Neufundland als erste nordische Siedlung in Amerika entdeckt worden. Doch 2021 gelang Wissenschaftlern ein Durchbruch: Mit Hilfe von hochpräziser Dendrochronologie konnte ein Stück Holz aus der Siedlung auf das Jahr 1021 n. Chr. datiert werden.
Damit besitzen wir heute die erste exakte Jahreszahl für einen europäischen Aufenthalt in Nordamerika im Mittelalter. Diese Entdeckung bestätigte nicht nur die Zuverlässigkeit der isländischen Sagas, sondern machte auch deutlich, dass die Wikinger die ersten Europäer in der Neuen Welt waren – ein halbes Jahrtausend vor Kolumbus.
Fazit
Die Jahre seit 2011 haben gezeigt, wie lebendig und dynamisch die Wikingerforschung heute ist. Neue Technologien wie DNA-Analysen, Georadar und präzise Dendrochronologie haben nicht nur spektakuläre Neuentdeckungen wie das Gjellestad-Schiff ermöglicht, sondern auch jahrzehntealte Rätsel gelöst – etwa die Datierung von L’Anse aux Meadows.
Schatzfunde wie der Galloway Hoard und das Silverdale-Depot haben unser Bild der Wikinger als Händler und Sammler globaler Kostbarkeiten geschärft. Gleichzeitig sorgten Funde wie die Birka-Kriegerin für intensive Debatten über Geschlechterrollen in der nordischen Gesellschaft.
Ob in den eisigen Pässen Norwegens, auf den britischen Inseln oder sogar in Nordamerika – die Archäologie der letzten Jahre zeigt, dass die Wikinger eine Kultur von enormer Reichweite und Vielfalt waren. Und sie beweist: Auch im 21. Jahrhundert lassen uns die Nordmänner noch immer staunen.
FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Wikingerfunden seit 2011
Gab es wirklich Wikingerkriegerinnen?
Der Fund der Birka-Kriegerin (2017 bestätigt) zeigt eindeutig, dass zumindest eine Frau mit Waffen und militärischer Ausrüstung bestattet wurde. Ob sie tatsächlich aktiv kämpfte, ist umstritten – doch der Fund beweist, dass Frauen in der Kriegerelite Platz haben konnten.
Warum ist das Gjellestad-Schiff so besonders?
Weil es das erste in Norwegen entdeckte Schiffsgrab seit über 100 Jahren ist – und weil es mit moderner Technik wie Georadar aufgespürt wurde, ohne den Boden zunächst zu öffnen.
Welche Rolle spielt der Klimawandel für die Archäologie?
Schmelzende Gletscher wie am Lendbreen-Pass legen Funde frei, die zuvor Jahrtausende verborgen waren. So dramatisch die Ursache ist – für die Forschung eröffnet sich dadurch ein völlig neuer Zugang zu Alltagsgegenständen der Wikingerzeit.
Warum ist die Datierung von L’Anse aux Meadows wichtig?
Weil wir damit erstmals eine exakte Jahreszahl (1021 n. Chr.) für einen europäischen Aufenthalt in Nordamerika haben. Das macht den transatlantischen Kontakt historisch greifbar wie nie zuvor.
Die Wikinger faszinieren uns bis heute – und jedes Jahr kommen neue Funde ans Licht.
Wenn dich diese Serie über die Wikingerfunde begeistert hat, dann abonniere meinen Newsletter, um keine weiteren Artikel über Archäologie, Mythologie und Kultur der Nordmänner zu verpassen!


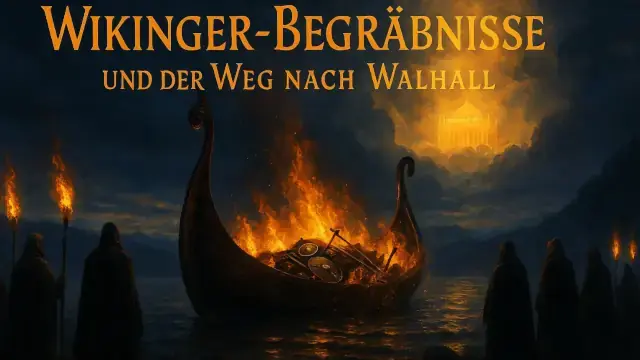







Kommentare