Die gefährlichsten Wikinger-Anführer aller Zeiten! (Mit Video)
- Michael Praher

- 5. Mai 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 12. Aug. 2025

Inhaltsverzeichnis:
Furchtlose Krieger, geniale Strategen und brutale Machtmenschen
Wenn wir an Wikinger denken, erscheinen vor dem inneren Auge oft bärtige Männer mit Axt und Schild, die in langen Schiffen über das Meer ziehen – auf Beutezug in fernen Ländern. Doch diese martialischen Bilder sind nur die Oberfläche einer vielschichtigen Realität. Hinter den erfolgreichen Raubzügen, kriegerischen Unternehmungen und gewagten Entdeckungsfahrten standen Männer, die mehr waren als bloße Krieger: charismatische Anführer, geniale Taktiker und – nicht selten – gnadenlose Machthaber.
In diesem Beitrag werfen wir einen genauen Blick auf die gefährlichsten und einflussreichsten Wikinger-Anführer der Geschichte – Männer, deren Namen sich tief ins kollektive Gedächtnis eingebrannt haben, sei es durch historische Quellen oder die Erzählkunst der Sagas.
Ragnar Lodbrok – Der Archetyp des Wikingerhelden
Ragnar Lodbrok ist zweifellos eine der ikonischsten Gestalten der Wikingerzeit. Er gilt als Inbegriff des nordischen Kriegers – unerschrocken, listig, stolz –, doch sein historischer Status bleibt umstritten. War Ragnar eine reale Person oder vielmehr eine literarische Konstruktion?
Mythos und Realität
Der Name „Ragnar Loðbrók“ bedeutet so viel wie „Ragnar mit den haarigen Beinkleidern“ – ein Beiname, der sich angeblich auf ein mit Teer und Fell verstärktes Kleidungsstück bezieht, das ihn vor Giftschlangen schützte. Der Legende nach war Ragnar der Sohn des Königs Sigurd Ring und führte zahlreiche Plünderungen an – darunter die berüchtigte Belagerung von Paris um das Jahr 845 n. Chr.
Besonders berüchtigt ist die Geschichte seines Todes: Der angelsächsische König Ælla soll ihn in eine Schlangengrube geworfen haben. Doch Ragnars Tod war nicht das Ende seiner Legende – vielmehr der Auftakt einer grausamen Rachegeschichte seiner Söhne, die England heimsuchten.
Historischer Hintergrund
Ob es Ragnar tatsächlich gab, bleibt ungewiss. Wahrscheinlich ist, dass sein Name ein Sammelbegriff für mehrere historische Persönlichkeiten war, darunter Reginherus, der 845 Paris überfiel. In den altnordischen Sagas verschmelzen historische Elemente mit Mythen zu einer überhöhten Figur – ein archaisches Idealbild eines Wikingerführers, das bis heute nachwirkt.
Ivar der Knochenlose – Der Stratege der Angst
Ivar Ragnarsson, genannt „der Knochenlose“ (altnordisch: Ívarr hinn Beinlausi), war einer der mutmaßlichen Söhne Ragnars und ein herausragender Kommandeur des „Großen Heidnischen Heeres“, das ab 865 n. Chr. in England wütete. Sein Beiname bleibt bis heute rätselhaft: Einige vermuten eine genetische Erkrankung wie Osteogenesis imperfecta, andere sehen darin eine Metapher für seine Beweglichkeit im Kampf.
Der Aufstieg eines Taktikers
Ivar war kein gewöhnlicher Krieger – er war ein Meister der Strategie. Unter seiner Führung wurde das Große Heidnische Heer zu einer effektiven Eroberungsmaschinerie. Anders als viele Wikingerführer setzte er nicht nur auf rohe Gewalt, sondern verstand sich auf Bündnisse, politische Intrigen und psychologische Kriegsführung.
Ein Beispiel: Nach der angeblichen Ermordung seines Vaters durch König Ælla von Northumbria kehrte Ivar mit überwältigender Stärke zurück – und soll grausame Rache genommen haben. Der überlieferte Blutadler, eine brutale Hinrichtungsmethode, wird oft mit ihm in Verbindung gebracht – auch wenn die historische Genauigkeit dieser Praxis umstritten ist.
Einfluss und Vermächtnis
Ivar war ein Anführer, der mit Kalkül Angst schürte. Seine Taten markierten eine neue Phase der Wikingerzeit – weg von plötzlichen Überfällen hin zu langfristiger Besetzung und Machtsicherung. Auch wenn sein genauer Tod nicht überliefert ist, blieb sein Name gefürchtet – in England ebenso wie in den Sagas des Nordens.
Björn Eisenseite – Der Grenzgänger zwischen Krieg und Entdeckung
Björn Járnsíða, bekannt als „Björn Eisenseite“, wird in den Sagas als einer der Söhne Ragnars geführt – mutig, kampferprobt und zugleich von außergewöhnlichem Entdeckergeist erfüllt. Sein Beiname verweist auf seine angeblich unverwundbare Flanke, ein Sinnbild für Härte und Durchhaltevermögen.
Raubzüge bis ans Ende der bekannten Welt
Im Gegensatz zu vielen seiner Zeitgenossen führte Björn keine kurzen Überfälle, sondern groß angelegte Expeditionen durch, die ihn weit über die Grenzen Nordeuropas hinausführten:
Er plünderte entlang der westfränkischen und spanischen Küste.
Seine Flotten drangen ins Mittelmeer vor – eine kaum gekannte Route für Wikinger.
Berichten zufolge erreichte er Italien und sogar Nordafrika, wo er gegen arabische Kräfte kämpfte.
Solche Unternehmungen erforderten nicht nur Mut, sondern auch logistisches Geschick, strategisches Denken und ein Gespür für Geografie.
Bedeutung für das Wikingertum
Björn Eisenseite verkörpert die Expansion des Wikingertums in seiner dynamischsten Phase. Er war nicht nur ein Raubritter, sondern ein Pionier, der neue Handels- und Plünderpfade eröffnete. In gewissem Maße war er auch ein Vorläufer späterer Kolonisatoren, die über das Meer neue Welten erschlossen.
Harald Schönhaar – Der Königsmacher Norwegens
Harald Hårfagre („Schönhaar“) war kein klassischer Wikingerraider, sondern ein politischer Visionär mit dem Ziel, Norwegen zu einen. Seine Herrschaft markiert den Übergang von einer Zeit lokaler Kleinkönige zu einem zentralisierten Königreich.
Aufstieg zur Macht
Laut der Heimskringla schwor Harald, sich erst dann die Haare zu schneiden, wenn er ganz Norwegen unterworfen habe – ein symbolisches Versprechen, das seinem Beinamen zugrunde liegen soll. Der Weg dorthin war blutig:
Er führte zahlreiche Kämpfe gegen rivalisierende Jarle und Kleinkönige.
Die entscheidende Schlacht von Hafrsfjord um 872 n. Chr. brachte ihm den Durchbruch.
Danach galt Harald als der erste König, der ganz Norwegen unter einer Krone vereinte – wenn auch nicht dauerhaft zentralisiert.
Langfristiger Einfluss
Haralds Machtpolitik zwang viele unzufriedene Jarle zur Auswanderung – insbesondere nach Island, Grönland und auf die Färöer. So wurde seine Herrschaft indirekt zum Motor für die skandinavische Expansion in den Nordatlantik. Im Gegensatz zu legendären Kriegern war er ein Staatsgründer – und damit gefährlich in einer ganz anderen Dimension: durch Systematik, langfristige Planung und Kontrolle über Menschenströme.
Egil Skallagrimsson – Der Berserker mit der Feder
Egil Skallagrímsson ist eine der faszinierendsten Persönlichkeiten der isländischen Literatur. Als Hauptfigur der Egils Saga tritt er nicht nur als Krieger, sondern auch als Dichter auf – ein Mann, der töten konnte und gleichzeitig mit Versen Unsterblichkeit suchte.
Gewalt und Genialität
Bereits als Kind zeigte Egil seine Wut: Mit sieben Jahren soll er bei einem Streit einen Gleichaltrigen erschlagen haben. Später führte er Raubzüge durch:
Er kämpfte in England und Norwegen.
Er war Teil politischer Intrigen, Rachefeldzüge und persönlicher Fehden.
Egil war ein typischer Berserker: unberechenbar, zornig, mächtig – aber auch intelligent und kultiviert.
Poetische Macht
Seine Skaldendichtung gilt als Höhepunkt altnordischer Poesie. Besonders berühmt ist sein Klagelied „Sonatorrek“, das er nach dem Tod seines Sohnes verfasste – ein Gedicht voller Schmerz, Stolz und philosophischer Tiefe.
Egil zeigt, dass auch in der Welt der Wikinger der Geist eine tödliche Waffe sein konnte. Seine gefährliche Natur lag nicht nur in seinen körperlichen Fähigkeiten, sondern in seiner Fähigkeit, Emotionen zu schärfen wie ein Schwert.
Olaf Tryggvason – Der Kreuzritter des Nordens
Olaf Tryggvason war ein Krieger, König und Christianisierer – und einer der polarisierendsten Herrscher Skandinaviens. Er verkörperte die Radikalität religiöser Umbrüche in einer Zeit, in der alte Götter dem Christentum weichen mussten – oft mit Gewalt.
Vom Exilkind zum Missionar mit Schwert
Olaf wurde auf See geboren und wuchs größtenteils im Ausland auf – in Russland, später in England. Seine Rückkehr nach Norwegen war keine Heimkehr, sondern eine religiös-politische Kampagne:
Ab ca. 995 n. Chr. regierte er Norwegen als König.
Seine Hauptmission war die Zwangschristianisierung des Landes.
Er ließ heidnische Heiligtümer zerstören und Menschen, die sich der Taufe verweigerten, grausam bestrafen.
Er trat als eine Art „Krieger Gottes“ auf – mit dem Kreuz in der einen und dem Schwert in der anderen Hand.
Zwischen Glaube und Fanatismus
Olaf war nicht nur ein Machtpolitiker – er glaubte an seine Mission. Aber seine Brutalität machte ihn ebenso gefürchtet wie gehasst. Sein Tod bei der Schlacht von Svolder (ca. 1000 n. Chr.) war eine Zäsur – und das Ende eines der härtesten Herrscher der Wikingerzeit.
Leif Eriksson – Der Entdecker der Neuen Welt
Leif Eriksson, der Sohn von Erik dem Roten, war kein Heerführer oder Tyrann – sondern ein ruhiger Visionär. Seine Bedeutung liegt nicht in der Zerstörung, sondern in der Entdeckung: Er gilt als der erste Europäer, der Nordamerika betrat – rund 500 Jahre vor Christoph Kolumbus.
Die Reise nach Vinland
Um das Jahr 1000 segelte Leif von Grönland aus nach Westen und erreichte ein fruchtbares Land, das er „Vinland“ nannte – vermutlich Neufundland:
Er folgte dem Bericht eines Kaufmanns namens Bjarni Herjólfsson, der das Land zufällig gesichtet hatte.
Leif organisierte eine Expedition, landete an mehreren Küstenabschnitten und errichtete eine kleine Siedlung.
Es kam zu Kontakten – und Konflikten – mit den indigenen Völkern („Skrælingar“ in den Sagas).
Leif war kein Eroberer, sondern ein Forscher. Doch seine Tat war revolutionär – sie sprengte den Horizont der bekannten Welt.
Warum Leif gefährlich war – anders als die anderen
In einer Zeit, in der Macht oft durch Krieg definiert wurde, war Leif gefährlich durch sein Denken. Er erweiterte die Weltkarte der Wikinger, eröffnete die Tür zur Globalisierung – auch wenn die Siedlungen nicht dauerhaft Bestand hatten.
Erik der Rote – Der Pionier im Exil
Erik der Rote war Leifs Vater – ein wilder, kompromissloser Mann, dessen Temperament ihn in Konflikt mit den Regeln der Gesellschaft brachte. Zweimal wurde er verbannt – und nutzte beide Male die Strafe als Chance zur Expansion.
Vom Mörder zum Siedlungsgründer
Ursprünglich aus Norwegen, wurde Erik nach Island verbannt – wegen eines Tötungsdelikts.
In Island verwickelte er sich erneut in Streitigkeiten und wurde abermals verstoßen.
Daraufhin segelte er nach Westen – in das unbekannte Grönland – und gründete dort 985 n. Chr. die erste dauerhafte Siedlung.
Erik war hart, unerbittlich – aber auch visionär. Er nannte das karge Land „Grünland“ („Grœnland“), um Siedler anzulocken – ein frühes Beispiel für Propaganda.
Sein gefährliches Vermächtnis
Eriks Taten zeigen die Schattenseite des Pioniergeistes: Expansion durch Exil, Landnahme aus Not, Gewalt als Triebkraft. Er steht sinnbildlich für jene Wikinger, die nicht aus Neugier segelten, sondern aus Zwang – und dabei neue Welten erschlossen.
Fazit: Keine Helden – sondern mächtige Männer ihrer Zeit
Die gefährlichsten Wikinger-Anführer waren nicht einfach Krieger mit Äxten und Schiffen – sie waren Persönlichkeiten mit enormem Einfluss, die ihre Zeit prägten: durch Krieg, Expansion, Religion oder Entdeckung. Was sie verband, war nicht nur Mut oder Brutalität, sondern strategisches Denken, Charisma und ein unerschütterlicher Wille.
Einige, wie Ivar der Knochenlose oder Olaf Tryggvason, führten gnadenlose Kampagnen gegen ihre Feinde. Andere, wie Björn Eisenseite oder Leif Eriksson, wagten sich weit über die Grenzen des Bekannten hinaus. Und Männer wie Harald Schönhaar oder Erik der Rote schufen politische Tatsachen, die über Generationen nachwirkten.
Doch so unterschiedlich ihre Methoden waren – sie alle veränderten die Welt. Ihre Geschichten sind keine Märchen über glorreiche Helden, sondern Spiegelbilder einer rauen Zeit voller Machtkämpfe, Grenzüberschreitungen und Umbrüche.
Zeitleiste – Die gefährlichsten Wikinger-Anführer im Überblick
Jahr | Ereignis | Anführer |
ca. 793 | Überfall auf Lindisfarne (Beginn der Wikingerzeit) | – |
ca. 845 | Plünderung von Paris | Ragnar Lodbrok (angeblich) |
865 | Landung des Großen Heidnischen Heeres in England | Ivar der Knochenlose |
ca. 870 | Mittelmeerzüge | Björn Eisenseite |
ca. 872 | Schlacht von Hafrsfjord, Einigung Norwegens | Harald Schönhaar |
ca. 930 | Egils Kämpfe und Dichtkunst auf Island | Egil Skallagrimsson |
995–1000 | Zwangschristianisierung in Norwegen | Olaf Tryggvason |
ca. 1000 | Entdeckung von Vinland (Nordamerika) | Leif Eriksson |
ab 985 | Besiedlung Grönlands | Erik der Rote |
FAQ – Häufig gestellte Fragen
Waren die berühmten Wikinger-Anführer wirklich so grausam?
Viele waren gnadenlos im Kampf – doch ebenso strategisch klug. Grausamkeit war oft Teil der Kriegsführung und Machtdemonstration, entsprach aber den Maßstäben ihrer Zeit.
Gab es auch weibliche Wikinger-Anführer?
Es gibt Hinweise auf weibliche Kriegerinnen und Siedlerinnen, wie Lagertha oder Freydis Eiriksdottir, doch sie waren Ausnahmen. Die Führungsrolle lag meist bei Männern.
Haben alle Wikinger geplündert?
Nein. Nicht jeder Wikinger war ein Plünderer – viele waren Händler, Bauern oder Siedler. „Wikinger“ war eher ein Beruf als eine ethnische Zugehörigkeit (siehe dazu auch den separaten Artikel „Wikinger – Ein Beruf, keine Ethnie“).
Warum wurde Leif Eriksson nicht so berühmt wie Kolumbus?
Seine Entdeckung geriet aus Sicht Europas in Vergessenheit, weil sie keine dauerhafte Kolonie nach sich zog und außerhalb des mittelalterlichen Christentums lag. Erst moderne Archäologie bestätigte seine Pionierleistung.


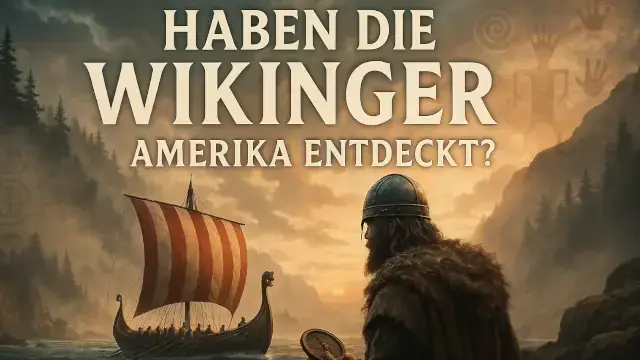








Kommentare