Runensteine entschlüsselt – Was ist ihre Bedeutung?
- Michael Praher

- 7. Aug. 2025
- 8 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 25. Aug. 2025

Inhaltsverzeichnis:
🔸 FAQ
Einleitung: Sprachlose Steine, die doch sprechen
Über Jahrhunderte hinweg standen sie schweigend in skandinavischen Landschaften, an Straßenrändern, auf Grabhügeln oder vor Kirchen: geheimnisvolle, mit seltsamen Zeichen bedeckte Runensteine. Viele Menschen sehen sie als bloße Zeugnisse vergangener Zeiten – archaische Dekoration aus der Welt der Wikinger. Doch wer die Runenschrift versteht, erkennt: Diese Steine reden. Sie erzählen Geschichten von Mut und Trauer, von Familien, Macht und Glauben – und von einer Kultur, die viel mehr war als nur raubend und brandschatzend.
In diesem Artikel tauchen wir tief ein in die Welt der Runensteine. Wir entschlüsseln, was wirklich auf ihnen steht, welche Botschaften sie uns überliefern – und was das über die Wikinger und ihre Vorfahren verrät.
Was sind Runensteine überhaupt?
Definition und Verbreitung

Runensteine sind meist große, aufrecht stehende Steine, die mit Inschriften in Runenschrift versehen sind – zumeist in der älteren oder jüngeren Futhark. Sie wurden überwiegend in Skandinavien zwischen dem 4. und 12. Jahrhundert errichtet, mit dem Höhepunkt während der Wikingerzeit (ca. 800–1050 n. Chr.).
Etwa 3.000 bekannte Runensteine stammen allein aus Schweden, viele weitere aus Dänemark und Norwegen. Einige tauchen auch in Gebieten auf, in die die Wikinger reisten – wie auf den Britischen Inseln oder in der Ukraine.
Die Runenschrift: Mehr als nur ein Alphabet
Runen sind keine „magischen Zeichen“ im klassischen Sinne, sondern zunächst ein Alphabet – das sogenannte Futhark, benannt nach den ersten sechs Buchstaben. Es gibt drei Hauptvarianten:
Älteres Futhark (ca. 150–800 n. Chr.): 24 Zeichen, meist auf Waffen, Schmuck oder Felsen.
Jüngeres Futhark (ca. 800–1100 n. Chr.): nur noch 16 Zeichen, Hauptschrift der Wikingerzeit.
Angelsächsisches Futhorc: Erweiterte Form mit bis zu 33 Zeichen, vor allem in England verwendet.
Die Zeichen selbst waren jedoch mehr als nur Buchstaben – viele trugen symbolische Bedeutungen. Die Rune Tiwaz stand nicht nur für den Laut „T“, sondern auch für den Kriegsgott Tyr und Begriffe wie Recht, Kampf und Ehre.
Weiterführende Artikel über die Runen, ihre Bedeutung und Verwendung, sowie eine Tabelle der Runen des älteren und jüngeren Futhark findest Du in diesen Artikeln:
Älteres Futhark – Runen und ihre Bedeutung
Rune | Name | Bedeutung (kurz) |
ᚠ | Fehu | Reichtum, Vieh, beweglicher Besitz |
ᚢ | Uruz | Urkraft, körperliche Stärke, Vitalität |
ᚦ | Thurisaz | Riese, Chaos, Abwehr, Schutz |
ᚨ | Ansuz | Göttliche Inspiration, Kommunikation, Odin |
ᚱ | Raido | Reise, Weg, Bewegung, Lebensrhythmus |
ᚲ | Kaunan | Feuer, Erkenntnis, Transformation |
ᚷ | Gebo | Geschenk, Austausch, Verbindung |
ᚹ | Wunjo | Freude, Harmonie, inneres Gleichgewicht |
ᚺ | Hagalaz | Hagel, Zerstörung, notwendiger Wandel |
ᚾ | Naudhiz | Not, Einschränkung, Überwindung |
ᛁ | Isa | Eis, Stillstand, Klarheit |
ᛃ | Jera | Ernte, natürlicher Zyklus, Belohnung |
ᛇ | Eiwaz | Eibe, Übergang, Tod & Wiedergeburt |
ᛈ | Perthro | Schicksal, Mysterium, verborgenes Wissen |
ᛉ | Algiz | Schutz, Instinkt, spirituelle Verteidigung |
ᛋ | Sowilo | Sonne, Erfolg, Energie, Lebensfreude |
ᛏ | Tiwaz | Ehre, Mut, Gerechtigkeit, Kriegergeist |
ᛒ | Berkano | Geburt, Fruchtbarkeit, weibliche Energie |
ᛖ | Ehwaz | Pferd, Vertrauen, Fortschritt |
ᛗ | Mannaz | Mensch, Selbst, soziale Struktur |
ᛚ | Laguz | Wasser, Intuition, emotionale Tiefe |
ᛜ | Ingwaz | Samen, Potenzial, innere Reife |
ᛞ | Dagaz | Tageslicht, Erwachen, Transformation |
ᛟ | Othala | Erbe, Heimat, spirituelle Wurzeln |
Was steht wirklich auf den Runensteinen?
Gedenksteine für Verstorbene
Der häufigste Anlass für Runeninschriften war das Gedenken an verstorbene Angehörige. Viele Steine beginnen mit einer Formulierung wie:
„X errichtete diesen Stein nach Y, seinem Vater/Bruder/Freund.“
Diese scheinbar einfachen Botschaften sind jedoch tiefgründig. Sie verraten etwas über soziale Bindungen, Erbfolgen, Familienstrukturen und sogar über Handelsreisen, Pilgerfahrten oder Todesarten.
Beispiel: Der Jellingstein in Dänemark – errichtet von König Harald Blauzahn – berichtet nicht nur vom Tod seines Vaters, sondern auch davon, dass er „die Dänen christianisierte“.

Runensteine als politische und religiöse Botschaften
Macht durch Stein: Runen als Statussymbol
Nicht jeder konnte oder durfte einen Runenstein errichten. Diese Monumente waren teuer und aufwendig: Man benötigte Steinmetze, Runenmeister, Transportmittel und Platz auf öffentlichem Grund. Daher waren Runensteine häufig Ausdruck von Macht, Wohlstand und Einfluss – vor allem in ländlichen Regionen.
Ein gutes Beispiel ist der Ramsundritzung in Schweden, der nicht nur eine Runeninschrift trägt, sondern auch eine aufwendig gemeißelte Szene aus der Sigurd-Sage zeigt. Der Text wirkt beinahe nebensächlich – das Bild erzählt die Geschichte eines berühmten Helden. Diese Mischung aus Mythos, Text und Bild war mehr als Trauerarbeit: Sie war Inszenierung.
Auch das Erwähnen berühmter Reisen – etwa nach Griechenland („austarla i Grikkium“) oder das Dienen in der Warägergarde – diente dazu, Ansehen in der Heimat zu mehren. Der Stein selbst wurde zum ewigen Zeugnis dieses Ruhms.
Zwischen Heidentum und Christentum
Besonders faszinierend ist die religiöse Doppeldeutigkeit vieler Inschriften. In der Übergangszeit zwischen heidnischer Götterwelt und christlicher Mission tauchen auf einem Stein häufig beide Welten auf – ohne Widerspruch.
Viele Runensteine enden mit der Bitte:
„Möge Gott seiner Seele helfen.“
Diese Formulierung zeigt, dass der Verstorbene (oder die Familie) sich zumindest dem neuen Glauben angeschlossen hatte. Doch gleichzeitig zieren viele dieser Steine weiterhin Drachen, Schlangen oder Sonnenräder – Symbole, die tief im germanischen Glauben verwurzelt sind.
Der Kuli-Stein in Norwegen ist besonders bemerkenswert: Er erwähnt explizit die Einführung des Christentums in Norwegen – eine Art Gesetz auf Stein. Damit wurde der Runenstein selbst zu einem Zeugnis des religiösen Wandels.
Runensteine als Wegweiser und Rechtsinstrument
Landmarken und Besitzmarkierungen
Manche Runensteine dienten sehr praktischen Zwecken: Sie markierten Grenzen, Wege oder Besitzverhältnisse. In Dänemark wurden Steine entlang wichtiger Straßen errichtet – manchmal sogar mit Angaben über Entfernungen oder Zielorte.
Ein Beispiel dafür ist die Skåäng-Inschrift, die einen Weg beschreibt und gleichzeitig einem Verstorbenen gedenkt. Diese Funktion als „Gedenkschild am Wegesrand“ erinnert an heutige Wegkreuze oder Gedenktafeln.
Recht auf Stein gemeißelt
In einzelnen Fällen belegen Runensteine auch rechtliche Ansprüche oder Verpflichtungen. Ein berühmtes Beispiel ist der Södermanland-Stein 333, auf dem eine Frau namens Gyrid eine Brücke stiften ließ – vermutlich als christliches Seelenheil-Werk. In der Inschrift heißt es:
„Sie ließ die Brücke errichten für die Seele ihres Ehemanns.“
Das war keine reine Frömmigkeit: Brückenbau war ein zentraler Beitrag zur Gemeinschaft, und solche Stiftungen wurden öffentlich gemacht – durch Runensteine. So sicherte man sich Anerkennung, Ansehen und vermutlich auch göttlichen Lohn.
Wie liest man einen Runenstein?
Vom Stein zur Sprache
Ein Runenstein wirkt auf den ersten Blick wie ein Chaos aus Linien und Zeichen. Doch wer die Runen kennt und ihren Aufbau versteht, kann sie oft erstaunlich präzise entziffern. Der erste Schritt besteht in der Transkription: Dabei wird der Runentext in lateinische Buchstaben übertragen – buchstabe für buchstabe.
Beispielhaft der berühmte Jellingstein von Harald Blauzahn:
Runenform: ᚼᛅᚱᛅᛚᛏᚢᚴᚼᚢᛘᛅᚾᚴᛁᚼTranskription: haraltr kunukʀÜbersetzung: Harald der König
Die nächste Stufe ist die Übersetzung ins moderne Deutsch oder Englisch – und hier wird es kompliziert. Denn Runeninschriften verzichten oft auf Artikel, Pronomen oder Hilfsverben. Dazu kommt, dass manche Worte heute nicht mehr eindeutig verstanden werden oder nur aus dem Kontext erschlossen werden können.
Rätselhafte Zeichen und versteckte Botschaften
Viele Runensteine enthalten ungewöhnliche Varianten einzelner Zeichen oder Mischformen, die nicht in standardisierten Runenalphabete passen. Das ist kein Zufall: Manche Runenmeister verwendeten persönliche Stile oder sogar bindrunes – verbundene Zeichen, bei denen mehrere Runen in einem Symbol zusammenlaufen.
Diese Bindrunen erschweren die Entzifferung, erhöhen aber gleichzeitig den symbolischen Wert: So konnten beispielsweise die Anfangsbuchstaben von Namen zu einem Monogramm verschmolzen werden – ähnlich wie bei Wappen oder Initialen im Mittelalter.
Außerdem findet man gelegentlich sogenannte Geheimrunen oder verschlüsselte Formen: etwa um magische Inhalte zu verschleiern oder Eingeweihten bestimmte Informationen zugänglich zu machen.
Mythen und Missverständnisse: Was Runensteine nicht sind
Keine „Zaubersteine“ im Fantasy-Sinn
Obwohl Runenmagie in der nordischen Mythologie eine große Rolle spielt (wie z. B. bei Odin oder der Edda), waren die meisten erhaltenen Runensteine keine magischen Objekte. Sie sollten nicht zaubern, verfluchen oder beschützen – sondern erinnern, dokumentieren, erzählen.
Viele moderne Missverständnisse stammen aus Esoterik, Popkultur oder Fantasy-Geschichten, in denen Runen mystische Kräfte oder geheimes Wissen verleihen. Auch die Verbindung von Runen mit Nationalsozialismus oder Okkultismus im 20. Jahrhundert hat ihr Bild stark verzerrt.
Kein fließender Text – sondern Formelhaftigkeit
Runensteine folgen bestimmten Mustern. Häufig beginnt ein Text mit der Nennung des Auftraggebers und endet mit einem Gedenken oder Segenswunsch. Viele Formeln wiederholen sich über Hunderte Kilometer hinweg – ein Runenstein war also keine freie Erzählung, sondern eine Art öffentlicher Formeltext.
Beispielhafte Formel:
„X ließ diesen Stein errichten nach Y, seinem Bruder/Vater/Sohn. Gott helfe seiner Seele.“
Das bedeutet nicht, dass alle Runensteine gleich sind – aber ihre Sprache folgt klaren Traditionen. Das zu erkennen ist ein Schlüssel zum Verständnis.
Zwischen Bild und Wort: Ikonographie und Symbolik auf Runensteinen
Bilder, Ornamente und Drachenköpfe
Viele Runensteine enthalten nicht nur Schriftzeichen, sondern auch kunstvoll gearbeitete Bilder und Ornamente. Vor allem im späten Wikingerzeitalter finden sich regelmäßig Drachen- und Schlangenmotive, die sich ringförmig um den Text winden. Diese Formen sind nicht nur dekorativ – sie rahmen den Text ein, führen das Auge entlang der Inschrift und verstärken die visuelle Wirkung.
Ein besonders eindrucksvolles Beispiel ist der Runenstein von Rök (Rökstenen) in Schweden. Er enthält sowohl Runen als auch Bildmotive und ist voll von mythologischen Anspielungen. Manche Forscher deuten ihn als eine Art „Rätselstein“ oder sogar als literarisches Kunstwerk – mit Bezug auf Ragnarök, Heldensagen und Runenmagie.
Moderne Runologie: Wie Forscher Runensteine lesen
Archäologie trifft Sprachwissenschaft
Die Entzifferung von Runen ist ein interdisziplinäres Unterfangen. Runologen analysieren nicht nur die Zeichen selbst, sondern auch:
den Stil der Runen (älteres oder jüngeres Futhark),
die Formulierungen und Formeln,
den Steinmetzstil und die Ornamentik,
archäologische Fundzusammenhänge,
geographische Verteilung der Steine.
Ein Runenstein wird also nicht isoliert gelesen, sondern immer im größeren kulturellen Kontext. Dadurch lassen sich z. B. Handelsrouten nachvollziehen, christliche Missionsbewegungen erkennen oder sogar dialektale Sprachunterschiede rekonstruieren.
Digitalisierung und KI in der Runenforschung
In den letzten Jahren erleben wir einen Aufschwung an digitalen Projekten, die Runensteine erfassen, fotografieren und dreidimensional rekonstruieren. Plattformen wie Runor.se oder das dänische Projekt DR 3D Runestone Project ermöglichen es Forscher*innen und Laien, Runensteine aus verschiedenen Winkeln zu betrachten, zu vergleichen und sogar virtuell zu entziffern.
Künstliche Intelligenz wird inzwischen dazu genutzt, fehlende Zeichen zu rekonstruieren, Lesarten zu vergleichen oder Inschriften mit bekannten Mustern abzugleichen. Trotzdem bleibt das Feld eine Mischung aus Wissenschaft – und detektivischer Intuition.
Was Runensteine uns heute noch sagen
Sprache der Erinnerung
Runensteine sind keine leblosen Artefakte. Sie sprechen – oft sehr direkt. Sie erzählen von Verlust, von Tapferkeit, von familiärem Stolz. Manche nennen Orte weit entfernter Kämpfe, andere betonen christlichen Glauben oder soziale Stellung. In ihrer Formelhaftigkeit schwingt echte menschliche Trauer mit.
Ein einfacher Satz wie „Gott helfe seiner Seele“ sagt viel über das sich wandelnde Weltbild der Wikingerzeit. Und ein Name wie „Toke, Sohn des Asgot“ lässt einen Menschen lebendig werden, dessen Spur sonst längst verweht wäre.
Identität, Stolz – und Warnung
Runensteine waren Zeichen. Zeichen von Status, Erinnerung, Botschaft. Heute erinnern sie uns daran, dass Schrift Macht bedeutet – und dass jede Inschrift ein Echo vergangener Leben ist. Sie zeigen, wie sich Kulturen verändern, wie Sprache vergeht und Geschichte sich in Stein meißelt.
Gleichzeitig mahnen sie zur Sorgfalt. Runen sind keine Spielerei, keine mystischen Tattoos ohne Sinn. Wer sie achtlos verwendet, übernimmt eine jahrtausendealte Stimme – oft, ohne zu wissen, was sie sagt.
FAQ: Runensteine und ihre Bedeutung
Was ist der älteste bekannte Runenstein?
Der älteste datierte Runenstein ist der Meldorf-Fibula (ca. 50 n. Chr.), allerdings ist der erste allgemein anerkannte Stein mit Runeninschrift der Einangstein aus Norwegen (ca. 400 n. Chr.). Der berühmte Rökstein stammt aus dem 9. Jahrhundert.
Wie viele Runensteine gibt es heute noch?
In Skandinavien kennt man über 3.000 Runensteine, die meisten davon in Schweden (v. a. in Uppland und Södermanland).
Welche Sprache steht auf den Runensteinen?
Die meisten Inschriften sind in Altnordisch oder einer älteren nordgermanischen Sprache verfasst – mit lokalem Einfluss. Die Schriftzeichen selbst sind Runen aus dem älteren oder jüngeren Futhark.
Gibt es auch christliche Runensteine?
Ja. Viele Steine aus dem 10. und 11. Jahrhundert enthalten christliche Segensformeln, Kreuze oder Bibelbezüge. Sie zeigen den religiösen Wandel der Wikingerzeit.
Wurden Runen nur auf Steine geschrieben?
Nein. Runen wurden auch auf Holz, Knochen, Metall und anderen Materialien geritzt – doch nur die Steine überdauerten die Zeit so zahlreich und gut lesbar.
Du willst noch tiefer in die Welt der Runen und die Bedeutung der Runensteine eintauchen? Dann wirf einen Blick auf meine Beiträge über die Runenmagie in der Edda oder wie die Wikinger wirklich lebten. Wenn dir der Artikel gefallen hat, teile ihn gern – und unterstütze meine Arbeit auf Ko-Fi, damit noch mehr Inhalte wie dieser entstehen können!


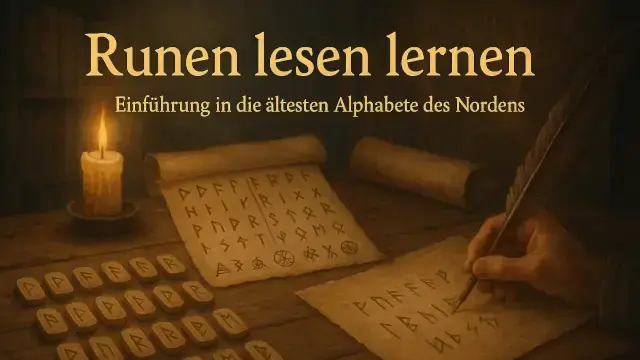







Kommentare