Wikinger – Ein Beruf, keine Ethnie (Mit Video)
- Michael Praher

- 5. Apr. 2025
- 6 Min. Lesezeit
Aktualisiert: 12. Aug. 2025

Inhaltsverzeichnis:
Einleitung: Mehr als nur Krieger mit Äxten
Wenn du das Wort „Wikinger“ hörst, denkst du wahrscheinlich an wilde Krieger mit Helmen und Äxten, an brennende Dörfer und brüllende Männer, die auf Drachenbooten über das Meer donnern. Doch dieses Bild ist nur ein kleiner Ausschnitt einer vielschichtigen Realität – und in vielen Punkten schlichtweg falsch. Tatsächlich war „Wikinger“ ursprünglich keine ethnische Bezeichnung, sondern eine Beschreibung einer bestimmten Tätigkeit. In Wahrheit waren die „Wikinger“ keine geschlossene Volksgruppe, sondern Menschen, die sich auf eine gefährliche, aber lukrative Lebensweise einließen: auf Raub, Entdeckung, Handel und Seefahrt.
Der Ursprung des Begriffs „Wikinger“
Der Begriff „Wikinger“ stammt aus dem Altnordischen – vermutlich von víkingr, was so viel bedeutet wie „Seeräuber“ oder „Plünderer“. Dabei ist wichtig zu verstehen:
víkingr bezeichnete nicht einen ethnischen Ursprung oder eine feste Gruppenzugehörigkeit, sondern eine Tätigkeit. Wer „auf Wiking ging“ (altnordisch fara í víking) begab sich auf eine Raub-, Entdeckungs- oder Handelsfahrt – oft mit dem Ziel, Ruhm, Reichtum oder neue Lebensräume zu gewinnen.
Das bedeutete: Nicht jeder Skandinavier war ein Wikinger. Im Gegenteil – die Mehrheit der Bevölkerung lebte als Bauern, Fischer, Handwerker oder Händler. Nur ein kleiner Teil entschied sich, auf See zu gehen. Das „Wikingersein“ war somit eher ein sozialer und wirtschaftlicher Status, den man erlangte – zeitweise oder dauerhaft.
Wer konnte ein Wikinger sein?
In der Wikingerzeit war es grundsätzlich jedem freien Mann möglich, „auf Wiking“ zu gehen. Voraussetzung war die nötige Ausrüstung, der Zugang zu einem Schiff – und der Wille, die Risiken einer solchen Fahrt auf sich zu nehmen. Besonders jüngere Männer, die keine Höfe oder Ländereien erben konnten, sahen in der Seefahrt eine Chance auf sozialen Aufstieg.
Die Wikingerfahrten waren aber nicht ausschließlich dem kriegerischen Adel vorbehalten. Auch Handwerker, Seeleute, Händler und manchmal sogar Frauen nahmen an diesen Unternehmungen teil – direkt oder indirekt. Während Frauen selten an Kampfeinsätzen beteiligt waren, reisten sie oft bei Siedlungsfahrten mit, etwa nach Island, Grönland oder Vinland (dem heutigen Neufundland), und spielten dort eine entscheidende Rolle beim Aufbau neuer Gemeinschaften.
Zudem schlossen sich manchmal Männer anderer Herkunft den Wikingergruppen an: Slawen, Franken, Kelten oder Sachsen konnten sich als Söldner oder Gefolgsleute anschließen. Besonders in der Kiewer Rus sind solche multikulturellen Strukturen gut belegt.
Wikingerfahrten: Zwischen Raub, Handel und Erkundung
Ein verbreitetes Missverständnis ist, dass Wikinger nur plünderten. Tatsächlich waren viele Wikinger auch geschickte Händler. Ihre Reisen führten sie von Skandinavien über die britischen Inseln und die Nordseeküste bis in den Mittelmeerraum, nach Nordafrika, in den Nahen Osten und tief hinein ins heutige Russland.
Sie handelten mit Pelzen, Walross-Elfenbein, Bernstein, Honig, Sklaven und Waffen – und erhielten im Gegenzug Silber, Seide, Wein, Gewürze und Luxusgüter. Archäologische Funde von arabischen Silbermünzen in Schweden oder byzantinischen Schmuckstücken in Dänemark belegen diese weitgespannten Netzwerke eindrucksvoll.
In vielen Fällen waren Raub und Handel keine Gegensätze, sondern gingen ineinander über: Man plünderte ein Kloster – und handelte später mit den Überlebenden. Städte wie York (Jórvik), Hedeby oder Dublin wurden von Wikingern nicht nur erobert, sondern auch zu blühenden Handelszentren ausgebaut.
Unterschied zwischen Wikingergruppen: Dänen, Norweger und Schweden
Oft spricht man pauschal von „den Wikingern“, als handle es sich um ein einheitliches Volk. Doch das ist ein Trugschluss. Die Wikinger waren keine ethnische Gruppe, sondern Menschen aus verschiedenen Teilen Skandinaviens, die sich für eine bestimmte Zeit dem Leben als Seefahrer, Händler oder Krieger verschrieben. Je nach Herkunft unterschieden sie sich deutlich in Zielen, Routen und Einflussbereichen.
Die Dänen
Dänische Wikinger konzentrierten sich vor allem auf den Westen. Sie überfielen England, Irland und das Frankenreich und ließen sich häufig dauerhaft nieder – etwa in der Normandie oder im Danelag, einem von Dänen kontrollierten Gebiet in England. Ihre Pläne reichten oft über bloßes Plündern hinaus: Sie wollten herrschen.
Die Norweger
Norwegische Wikinger segelten noch weiter: nach Schottland, Irland, auf die Isle of Man, die Orkney- und Shetlandinseln – und sogar bis nach Island, Grönland und kurzzeitig nach Nordamerika (Vinland). Viele von ihnen waren Entdecker und Siedler, die neue Lebensräume suchten, nicht nur Beute.
Die Schweden
Im Osten hingegen dominierten die schwedischen Wikinger – auch als Waräger bekannt. Sie nutzten die Flüsse Osteuropas als Handels- und Reiserouten, erreichten Kiew, Nowgorod und sogar Konstantinopel. Ihr Fokus lag weniger auf Raubzügen, sondern auf Fernhandel und dem Aufbau politischer Strukturen.
Das Ende der Wikinger als Berufsstand
Die Wikingerzeit war geprägt von Mobilität, Unabhängigkeit und der Suche nach Reichtum – doch dieses Lebensmodell war nicht für die Ewigkeit gemacht. Mit dem Wandel Europas veränderten sich die Spielregeln, und das „Wikingersein“ verlor seine Grundlage.
Politischer Wandel
In Skandinavien selbst setzten sich nach und nach starke Königtümer durch. Diese neuen Herrscher strebten nach Ordnung und zentraler Kontrolle – individuelle Raubzüge passten nicht mehr in ihr Bild von Macht und Stabilität. Auch die Christianisierung spielte eine zentrale Rolle: Plündern galt nun nicht mehr als ehrenvoll, sondern als Sünde.
Stärkere Gegner
Gleichzeitig professionalisierten sich die Verteidigungssysteme Europas. Küstenstädte waren nicht länger schutzlos, sondern gut befestigt. Immer mehr Regionen verfügten über stehende Heere und koordinierte Abwehrmaßnahmen. Raubzüge wurden riskanter und weniger profitabel.
Neue Wege
Viele ehemalige Wikinger passten sich an: Sie ließen sich in eroberten Gebieten nieder, wurden Bauern, Händler oder schlossen sich fremden Armeen an. Besonders bekannt ist die Warägergarde in Byzanz – eine Eliteeinheit aus nordischen Kriegern im Dienst des Kaisers. Andere, wie die Normannen, gingen noch weiter und gründeten eigene Reiche.
Das bleibende kulturelle Erbe der Wikinger
Auch wenn das Zeitalter der Wikinger vor über tausend Jahren endete, sind ihre Spuren bis heute sichtbar – in Sprache, Recht, Technik und Kultur. Ihr Erbe wirkt weit über Skandinavien hinaus.
Sprache und Ortsnamen
Viele Ortsnamen in England, Irland und Schottland gehen auf Wikinger zurück – besonders in Regionen wie dem Danelag. Begriffe wie „by“ (Dorf), „thorpe“ (Siedlung) oder „thwaite“ (Rodung) stammen aus dem Altnordischen. Auch im Englischen haben sich Wörter wie „sky“, „window“ oder „egg“ aus der Wikingerzeit erhalten.
Schifffahrt und Navigation
Wikinger galten als Meister der Seefahrt. Ihre Langschiffe waren nicht nur schnell und wendig, sondern auch hochseetauglich – ideal für Überraschungsangriffe, aber ebenso für Entdeckungsreisen. Techniken wie die Nutzung von Sonnensteinen zur Navigation beeindrucken Forscher bis heute.
Gesellschaft und Recht
In Island blieb das altwestnordische Rechtssystem lange erhalten. Das Althing – eines der ältesten Parlamente der Welt – wurde im Jahr 930 gegründet und bestand über Jahrhunderte. Es zeigt, dass Wikinger auch komplexe gesellschaftliche Strukturen kannten, nicht nur Kriegszüge.
Kultureller Einfluss
In vielen Ländern verschmolzen Wikinger mit der einheimischen Bevölkerung und prägten Gesellschaften nachhaltig – etwa als Normannen in Frankreich und England oder als Waräger in Russland und Byzanz. Ihre Nachfahren formten Königtümer, beeinflussten Adelshäuser und bauten Handelsnetzwerke auf, die bis in den Orient reichten.
Fazit: Was bedeutet es, ein Wikinger zu sein?
Ein Wikinger zu sein bedeutete nicht, einer bestimmten Ethnie anzugehören – es war eine Rolle, ein Beruf, eine Lebensweise. Wer in See stach, um zu handeln, zu plündern oder neue Länder zu entdecken, war in den Augen seiner Zeitgenossen ein Wikinger – ganz gleich, ob er aus Dänemark, Norwegen oder Schweden stammte.
Die Wikingerzeit war eine Phase außergewöhnlicher Mobilität, geprägt von Mut, Unternehmergeist und Anpassungsfähigkeit. Viele der sogenannten Wikinger waren Bauern oder Handwerker, die sich nur zeitweise dem Leben auf See verschrieben. Manche wurden zu Eroberern, andere zu Händlern oder Söldnern – aber alle trugen sie zum prägenden Bild dieser Epoche bei.
Heute wissen wir: Der „Wikinger“ war kein Volk, sondern eine Funktion in einer bestimmten historischen Situation. Doch gerade das macht ihn so faszinierend – weil er für Veränderung, Aufbruch und kulturellen Austausch steht. Seine Geschichten sind Geschichten von Bewegung, Herausforderung und Wandel. Und deshalb wirken sie bis heute nach.
FAQ – Häufige Fragen zu den Wikingern
Waren Wikinger ein Volk?
Nein. Wikinger waren keine ethnische oder nationale Gruppe, sondern Menschen aus Skandinavien (vor allem Dänemark, Norwegen und Schweden), die sich auf Raubzüge, Handel oder Entdeckungsfahrten begaben. „Wikinger“ war also eher ein Beruf oder eine Rolle.
Konnte jeder ein Wikinger sein?
Grundsätzlich ja – vorausgesetzt, er war Teil der skandinavischen Gesellschaft und nahm aktiv an den typischen Unternehmungen dieser Zeit teil. Viele Wikinger waren ursprünglich Bauern, die sich saisonal auf See begaben. Auch soziale Herkunft spielte eine Rolle: Nicht jeder hatte die Mittel für ein eigenes Schiff.
Gab es Frauen unter den Wikingern?
Ja, aber nicht in der gleichen Rolle wie Männer. Die meisten Wikinger waren männlich, doch es gibt Hinweise auf bewaffnete Frauen in Gräbern, sowie auf Frauen, die als Händlerinnen oder Siedlerinnen mitreisten. In der Gesellschaft der Wikinger hatten Frauen insgesamt mehr Rechte als in vielen anderen Kulturen ihrer Zeit.
Was unterscheidet Dänen, Norweger und Schweden in der Wikingerzeit?
Die Herkunft beeinflusste ihre Ziele:
Dänen zog es nach England und ins Frankenreich.
Norweger waren Siedler und Entdecker im Nordatlantik.
Schweden konzentrierten sich auf den Osten und handelten mit Byzanz und dem Kalifat.
Trotz regionaler Unterschiede verband sie alle die Lebensweise als Wikinger.
Wann endete die Wikingerzeit?
Die Wikingerzeit endete schrittweise zwischen dem späten 11. und frühen 12. Jahrhundert – je nach Region. Ursachen waren die Christianisierung, das Entstehen zentraler Königreiche, verbesserte Verteidigungsmaßnahmen und neue wirtschaftliche Strukturen.
Gibt es heute noch Nachfahren der Wikinger?
Ja. Viele Menschen in Skandinavien, Großbritannien, Irland, Nordfrankreich und Russland haben genetische oder genealogische Verbindungen zu den Wikingern. Auch viele Adelsfamilien können ihre Wurzeln auf Wikingerführer zurückverfolgen – z. B. die normannischen Herzöge und englischen Könige nach 1066.

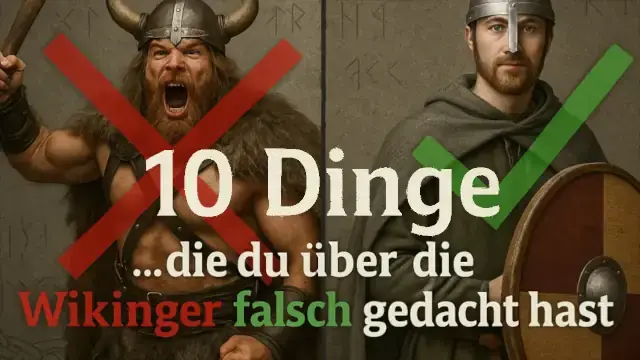









Kommentare